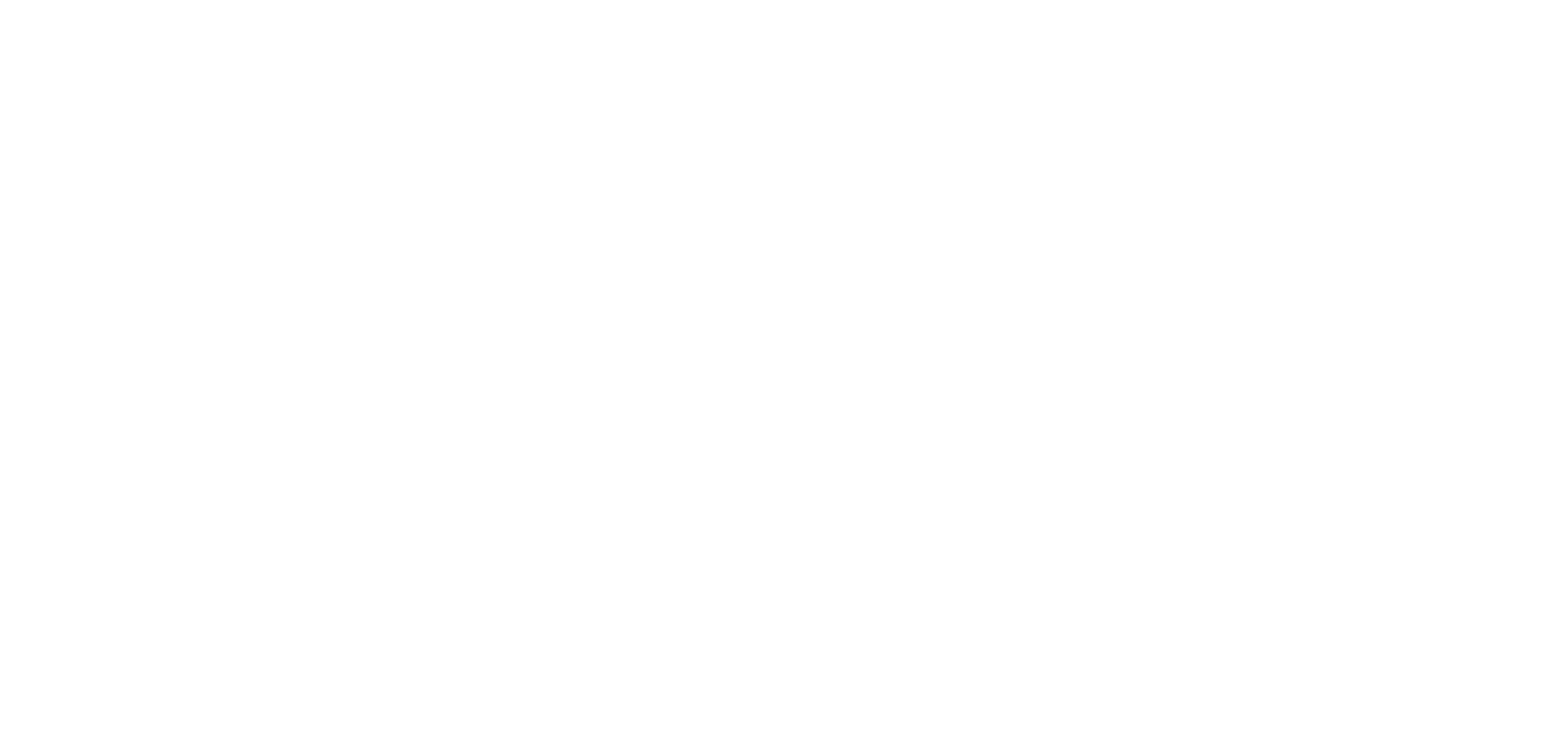
DMS Rechtsanwälte
Kanzlei für Wirtschaftsstrafrecht, Medizinstrafrecht, Steuerstrafrecht
Wir sind eine etablierte Kanzlei mit Standorten in München und Karlsruhe. Alle Partner sind Fachanwälte für Strafrecht. Wir beraten und vertreten natürliche und juristische Personen in allen Fragestellungen rund um das Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht. Als bewusst klein gehaltene Einheit arbeiten wir in allen Mandaten Hand in Hand.
Auf Grund unserer hervorragenden Kompetenzen insbesondere im Wirtschafts-, und Medizinstrafrecht werden wir regelmäßig in namhaften Fachmagazinen für unsere besondere Expertise ausgezeichnet. Wir sind zudem Unternehmensmitglied beim Berufsverband für Compliance Manager (BCM) e.V. sowie beim Deutschen Institut für Compliance e.V.
DMS Strafrecht – Unsere Kompetenzen im Überblick
Wir vertreten und beraten Sie in Fragen von Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren, die im Zusammenhang mit der Teilnahme am Arbeits- und Wirtschaftsleben stehen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die gegen Sie erhobenen Vorwürfe durch staatliche Ermittlungsbehörden, den Arbeitgeber, durch Dritte (z.B. Geschäftspartner oder Insolvenzverwalter) oder durch das Finanzamt erhoben werden.
Wirtschafts-
strafrecht
Steuer-
strafrecht
Wir beraten und verteidigen laufend in steuerstrafrechtlichen Großverfahren wie Cum/Ex- Deals oder Umsatzsteuerkarussellen. Daneben beraten wir Sie im Bereich Selbstanzeige, sowie Vermeidung von Strafverfahren durch Tax Compliance.
Wir verteidigen in Ermittlungs- und Strafverfahren im Bereich des Medizinstrafrechts, in dem zum einen die Aufarbeitung etwaiger Behandlungsfehler (Körperverletzung- und Tötungsdelikte), zum anderen Wirtschaftsstraftaten wie Abrechnungsbetrugs-, Korruptions- und Untreuedelikte im Vordergrund stehen. Wir decken hier das gesamte Spektrum des Medizinstrafrechts ab.
Medizin-
strafrecht
Criminal
Compliance
Health
Compliance
Unser Schwerpunkt liegt in der Beratung und Vertretung kleiner und mittelständischer Unternehmen in allen Fragestellungen mit strafrechtlichem Bezug. Im Rahmen der Compliance-Beratung erarbeiten wir individuelle Handlungsempfehlungen, die auf Ihr Unternehmen zugeschnitten sind. In einer Krisensituation stehen wir Ihrem Unternehmen als erfahrene und zuverlässige Ansprechpartner zur Seite.
Wir prüfen Ihre Erfolgsaussichten nach einer landgerichtlichen Verurteilung und fertigen ggf. eine fachgerechte Revisionsbegründung für Sie an. In geeigneten Fällen verfassen wir für Sie auch Verfassungsbeschwerden.
Revisionsrecht
Verfassungs-
beschwerden
Vermögens-
abschöpfung
Wir analysieren laufend die aktuelle Rechtsprechung zum Recht der Vermögensabschöpfung. Als ausgewiesene Experten auf diesem Gebiet beraten und vertreten wir Einziehungsbeteiligte sowohl im Rahmen eines Strafverfahrens als auch im Rahmen selbständiger Einziehungsverfahren.
Im Strafrecht stehen Existenzen auf dem Spiel. Aufgrund unser langjährigen Erfahrung wissen wir, was eine Inhaftierung, eine Kontenpfändung, eine Vorstrafe oder der Verlust der Fahrerlaubnis bedeuten kann. In dieser Situation sind wir für Sie da und kämpfen für Ihr Recht und Ihre Freiheit.
Strafrecht

Aktuelles
Die erste Auflage des Nomos Kommentars zum Medizinstrafrecht ist nun 2023 endlich erschienen.
Das von Prof. Dr. Tsambikakis und Prof. Dr. Rostalski herausgegebene Werk ist der einzige Kommentar, der sich ausschließlich dem Medizinstrafrecht...
Das vorläufige „Aus“ für die digitale Dokumentation der strafgerichtlichen Hauptverhandlung?
Gedanken unseres Partners Markus Meißner zum „Nein“ des Bundesrats zum „Entwurf eines Gesetzes zur digitalen Dokumentation der strafrechtlichen...
8. Unternehmensstrafrechtlichen Tage an der LMU in München
Zum Auftakt der 8. Unternehmensstrafrechtlichen Tage an der LMU in München stand gestern die "Vermögensabschöpfung in Unternehmen" im Fokus. Nach...



